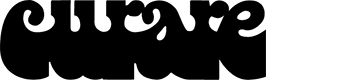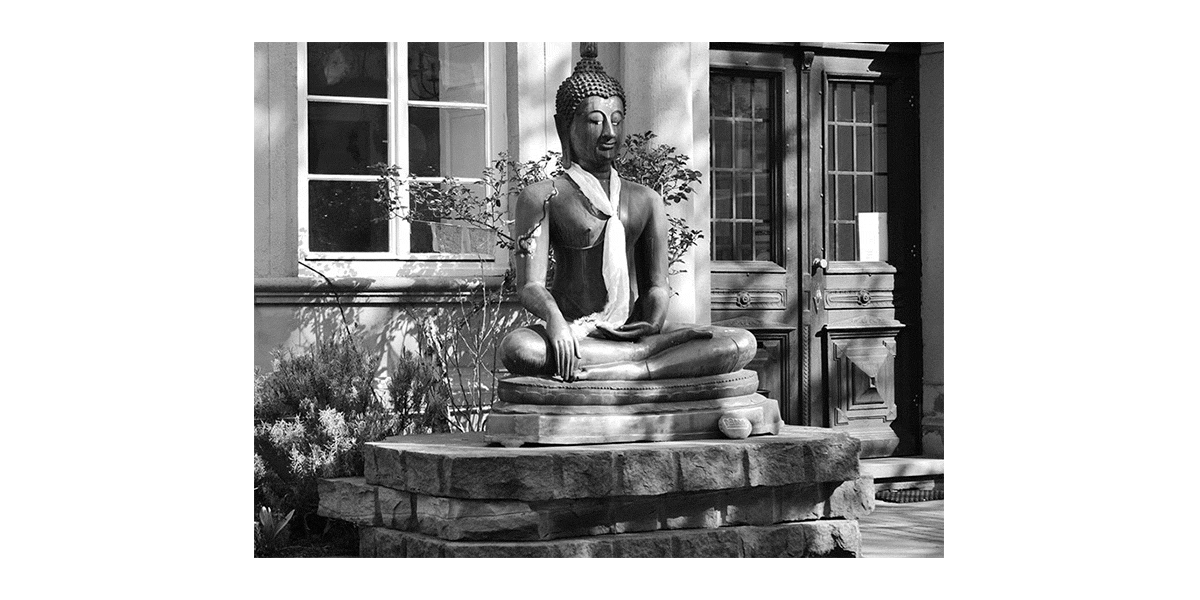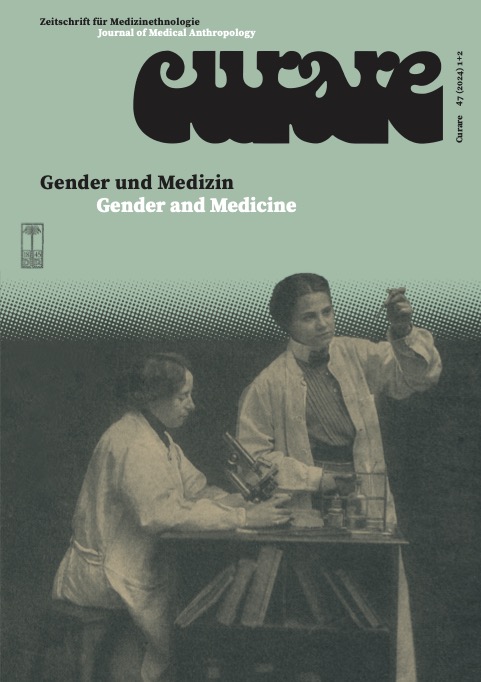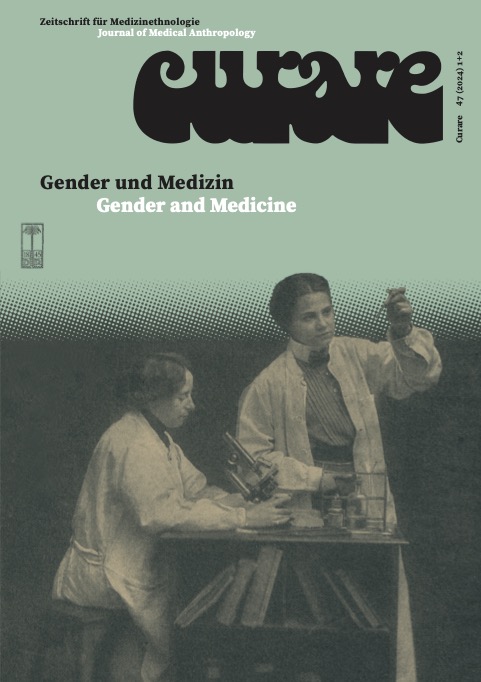Curare | Zeitschrift für Medizinethnologie | Journal of Medical Anthropology
Die Curare ist eine seit 1978 bestehende Zeitschrift für Medizinethnologie mit doppelblindem Begutachtungsverfahren, herausgegeben von der Arbeitsgemeinschaft Ethnologie und Medizin – AGEM. Beiträge werden auf Deutsch & English veröffentlicht. Der Wechsel in eine Open Access Journal erfolgte 2024 mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG). Alle Ausgaben ab 2018 werden veröffentlicht auf www.curarejournal.org. Die Ausgaben von 1978–2017 sind abrufbar auf dem Digitalisierungsserver des FID SKA - Fachinformationsdienst Sozial- und Kulturanthropologie unter www.evifa.de/curare-journal. Weiterhin wird eine Druckversion zur Verfügung stehen, die seit 2022 im Reimer Verlag Berlin erscheint.
Call for Papers – Abtreibung und Fehlgeburt: Narrative, Praktiken, Diskurse (Themenheft)
(Guest Editors: Dr. Florian Lützelberger, Otto-Friedrich-Universität Bamberg University of Oxford & Dr. Agnieszka Balcerzak, Ludwig-Maximilians-Universität München)
In La condition foetale (2004) beschreibt Luc Boltanski die Ambivalenz, die die kulturellen und gesellschaftlichen Umgangsweisen mit dem Fötus prägt: Er erscheint zugleich als unsichtbares medizinisches Objekt, als Projektionsfläche sozialer Erwartungen, als rechtlich normiertes Leben im Werden und als intimes Geheimnis. Diese Gleichzeitigkeit des Sichtbaren und Unsichtbaren, des Privaten und Politischen, der Körpererfahrung und der gesellschaftlichen Zuschreibung strukturiert in besonderer Weise auch die Erzählungen und Praktiken rund um Schwangerschaftsabbruch und Fehlgeburt. Damit ist der Fötus nicht nur ein Grenzfall individueller Erfahrung, sondern auch ein paradigmatisches Objekt biopolitischer Regulierung im foucaultschen Sinn: An ihm verdichten sich Diskurse, die über Leben, Körper und Bevölkerung verfügen und so normative Ordnungen von Sexualität und Reproduktion herstellen. Zugleich eröffnet sich ein Spannungsfeld, in dem unterschiedliche Öffentlichkeiten und Gegenöffentlichkeiten aufeinandertreffen: Während juristische und medizinische Diskurse den Fötus in Normen und Kategorien fassen, entstehen in autobiographischen, literarischen oder künstlerischen Darstellungen Räume, die sich der hegemonialen Logik entziehen. In diesem Sinne lassen sich viele Narrative über Abtreibung und Fehlgeburt auch als Formen dessen verstehen, was Lauren Berlant (2008) als counterpublics beschrieben hat: kommunikative Räume, in denen marginalisierte Erfahrungen artikuliert und gegen dominante moralische und politische Ordnungen in Stellung gebracht werden. Schwangerschaftsabbruch und Schwangerschaftsverlust erscheinen so nicht nur als medizinisch-rechtliche Fragen oder individuelle Schicksale, sondern als Schnittstellen, an denen sich Konflikte um Sichtbarkeit, Anerkennung und die Deutungshoheit über den gebärenden Körper verdichten.
Die gegenwärtigen Debatten um Abtreibung und Schwangerschaftsverlust zeigen die Dringlichkeit des Themas. Auf der einen Seite stehen weltweite Verschärfungen des Zugangs zu legalen Schwangerschaftsabbrüchen: Dazu gehören die 2021 in Kraft getretene restriktive Reform des Abtreibungsrechts in Polen sowie die Aufhebung von Roe v. Wade in den USA im Jahr 2022, die das seit 1973 bestehende konstitutionelle Recht auf Abtreibung beendet hat. Auf der anderen Seite gibt es jedoch auch bedeutende Liberalisierungen, wie etwa die 2018 erfolgte Legalisierung von Abtreibungen in Irland nach einem historischen Referendum oder die Verankerung des Rechts auf Abtreibung in der französischen Verfassung im Jahr 2024. Gleichzeitig bestehen weiterhin intensive Kontroversen über die sogenannte „fetal personhood“ von Embryonen und über staatliche Eingriffe in reproduktive Rechte und Technologien. Diese Debatten werden jedoch nicht allein in juristisch-politischen Arenen geführt, sondern spiegeln sich auch in literarischen, künstlerischen und autobiografischen Auseinandersetzungen wider. Das inzwischen vielleicht prominenteste Beispiel ist Annie Ernaux’ L’événement (2000), das in seiner kompromisslosen Nüchternheit ein zentrales Dokument feministischer Literaturgeschichte darstellt. Zugleich verdeutlicht der Text paradigmatisch, wie literarische Sprache Erfahrungen des Abbruchs und deren gesellschaftliche Verurteilung sichtbar macht und dabei die starke Individualität und Subjektivität solcher Erfahrungen prägnant hervorhebt. Ein ähnliches Anliegen verfolgt auch die portugiesische Künstlerin Paula Rego mit ihrer Serie Untitled. The Abortion Series (1998), einer Reihe großformatiger Pastelle, in der sie eindringlich die physischen und emotionalen Belastungen illegaler Schwangerschaftsabbrüche darstellt. Ihre Arbeiten entstanden unmittelbar im Kontext der politischen Auseinandersetzungen um das damalige Abtreibungsverbot in Portugal und wurden zu einem wichtigen visuellen Beitrag im öffentlichen Kampf, der 2007 in die Liberalisierung des Abtreibungsrechts mündete.
Das geplante Themenheft möchte die Interferenzen und Spannungen zwischen Körper, Medizin, Recht, Ethik, Gesellschaft und Subjektivität in Bezug auf Schwangerschaftsabbruch und Fehlgeburt in den Blick nehmen. Dabei sollen unterschiedliche zeitliche, kulturelle und soziale Kontexte berücksichtigt werden. Das Heft versteht sich als Plattform für eine interdisziplinäre Diskussion, die die lange medizinhistorische und anthropologische Dimension von Abtreibung und Fehlgeburt ebenso ernst nimmt wie deren aktuelle literarische, künstlerische und politische Aushandlungen. Ziel ist es, ein Panorama von Zugängen zu eröffnen, das die Schnittstellen von Körper, Wissen, Normen, Praktiken und Erfahrung in diesem hochsensiblen Feld sichtbar macht.
Wir laden Beiträge aus allen relevanten Disziplinen ein – unter anderem der Sozial- und Kulturanthropologie, Medizingeschichte, Medienwissenschaft, Soziologie, Hebammenwissenschaft, Humanmedizin, Rechts- und Geschichtswissenschaft, Literatur- und Kulturwissenschaft, Kunstgeschichte, Filmwissenschaft, Philosophie und Ethik, Gender Studies sowie den Medical/Health Humanities. Dabei sind interdisziplinäre Zugänge willkommen. Ebenso begrüßen wir Beiträge aus aktivistischen Kontexten und aus dem weiteren Umfeld politischer, sozialer oder künstlerischer Praxis, die sich mit Fragen rund um Abtreibung und Fehlgeburt auseinandersetzen.
Weitergehende Informationen auf unserer Call for Papers-Seite.
Online First
2025
- Wolfgang Bichmann, Walter Bruchhausen, Dieter Hampel, Michael Heidegger, Albrecht Jahn & Oliver Razum, Wolfgang Krahl, Pitt Reitmaier, Susan B. Rifkin, Ekkehard Schroeder & Stefan Schubert. Ein bedeutender Forscher, Lehrer und Ideengeber. Nachruf einiger Weggefährt*innen auf Hans-Jochen Diesfeld (1932–2025)
- Tobias Becker. Medien und Medizin als Ressourcen füreinander Polio-Schluckimpfung im BRD-Fernsehen der 1960er- und 70er-Jahre
Current Issue
48 (2024) 1+2
Schwerpunkt: Gender und Medizin
Hrsg. von Barbara Wittmann und Alena Mathis
Der Schwerpunkt erforscht historisch gewachsene und nachhaltend wirkende geschlechtsspezifische Ungleichgewichte in unseren medizinischen Strukturen und deren Einfluss auf den alltäglichen Umgang mit Krankheit und Gesundheit. Die Beiträge schließen an Erkenntnisse von kritisch-feministischen Initiativen und der Frauengesundheitsbewegung an. Sie fragen danach, warum Menschen abhängig vom Geschlecht unterschiedlich krank werden und wie mit diesen Erkrankungen aufgrund spezifischer soziokultureller Prägungen umgegangen wird. Historische Entwicklungen werden nachgezeichnet und darauf aufbauend aktuelle Bedingungen genderbezogener Machtverhältnisse untersucht. Der Begriff der „Gender-Medizin“ soll marginalisierte Perspektiven in den Fokus zu rücken, um die Betrachtung des cis-männlichen Körpers als medizinisch-pharmazeutische Norm zu überwinden, und ein neues Verständnis und einen Umgang mit Ungleichheiten in der klinischen Versorgung zu erreichen. Dabei soll die eurozentrische Blickverengung (selbst-)kritisch reflektiert werden, um die selten thematisierten kolonialen Auswirkungen der „medizinischen Expansion“ zu beleuchten. Wie die Beiträge dieser Ausgabe zeigen, ist „Gender-Medizin“ in vielen Teilen des medizinischen Betriebs noch eine Utopie bzw. ein „Nicht-Raum“. Die Curare-Redaktion ist froh darüber – in Abwesenheit eines Ortes, an dem die Medizin so praktiziert wird, wie es sich die Autor*innen und Forschungspartner*innen wünschen –, zumindest einen Denk-Raum eröffnen zu können. Wir hoffen, dass damit die Weiterentwicklung der Medizin hin zu einem inklusiveren und gerechteren Projekt anstoßen werden.