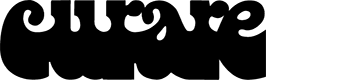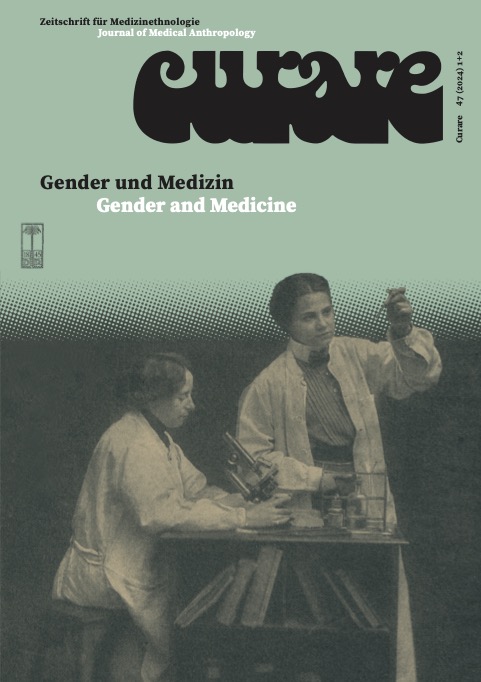Kritik an medizinisch-psychologischen Konzepten im post-genozidalen Ruanda
Zu Gender-Aspekten, kolonialen Perspektiven und der Vergessenheit des Materiellen in autobiografischen Zeugnissen von Esther Mujawayo und Révérien Rurangwa
DOI:
https://doi.org/10.60837/curare.v47i1-2.3838Keywords:
Tutsizid, Resilienz, Autobiografie, psychologische Konzepte, materielle GrundbedürfnisseAbstract
Der Genozid an den Tutsi Ruandas war der Kulminationspunkt einer langen Gewaltgeschichte. Die Massaker in den drei Monaten von April bis Juni 1994 haben über eine Million Menschen das Leben gekostet und lassen auch feministische Fragen in den Fokus treten: Durch die Massenvergewaltigungen waren viele Frauen mit dem HI-Virus angesteckt worden und dadurch, dass mehr Männer getötet worden waren, musste die Organisation des ,Danachʻ vor allem durch die weiblichen Überlebenden erfolgen. Im Zentrum der folgenden historisch informierten literaturwissenschaftlichen Studie zum Umgang mit ,Heilungsversuchenʻ und Gender-Aspekten in Ruanda stehen die Stimmen von Betroffenen selbst. Damit wird dem Plädoyer Mujawayos gefolgt, medizinisch-psychologische Hilfe viel stärker von den Patient:innen her zu definieren – und nicht in erster Linie von außenstehenden ,Spezialist:innenʻ, die im beschriebenen Kontext zudem paternalistische und koloniale Hierarchien reproduzierten. Die erste These, die im Beitrag dargelegt wird, lautet, dass aus autobiografischen Berichten von Überlebenden die stabilisierende Wirkung materieller Hilfe auch für die Psyche spricht. Die zweite These betrifft ,Heilungsversucheʻ, die auf das Auffinden der Getöteten angewiesen waren. Als dritte These wird auf die Unmöglichkeit wirklich heilender medizinischer Hilfe eingegangen, wobei Kritik am Begriff der ,Resilienzʻ geübt wird.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Curare. Journal of Medical Anthropology

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.